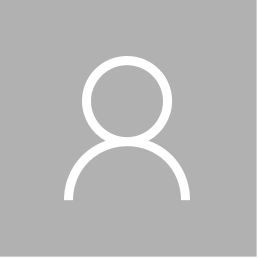von Marc Holitscher, National Technology Officer der Microsoft Schweiz.
Die letzten Wochen haben gezeigt, was digitale Technologien zur Krisenbewältigung leisten können. Sie haben es Unternehmen und Behörden ermöglicht, ihre tragenden Geschäftsabläufe aufrechtzuerhalten. Insbesondere Unternehmen, die schon erfahren sind mit digitalen Technologien, konnten schnell reagieren, was sich vor allem an der Kundenschnittstelle zeigte. Eine deutliche Beschleunigung liess sich auch industrieübergreifend feststellen in Organisationen, die bisher eher modernisierungsscheu waren. Mit verantwortlich dafür ist, dass laufende Abklärungen über die rechtliche Zulässigkeit und die Sicherheit von ausgewählten Cloud- und Online-Diensten aufgrund der aussergewöhnlichen Situation sistiert wurden. Dies gilt für den öffentlichen Bereich mehr noch als für den kommerziellen.
Entscheidend ist, dass die nun gemachten Erfahrungen angemessen berücksichtigt werden. Quasi automatisch zum Zeitpunkt vor der Krise zurückzukehren, als viele Technologien nicht oder nur restriktiv eingesetzt werden konnten, ist keine Option.
Diese wichtigen Diskussionen werden zur gegebenen Zeit wieder aufgenommen. Entscheidend ist dann, dass die nun gemachten Erfahrungen angemessen berücksichtigt werden. Quasi automatisch zum Zeitpunkt vor der Krise zurückzukehren, als viele Technologien nicht oder nur restriktiv eingesetzt werden konnten, ist keine Option. Dies hat nichts damit zu tun, dass professionelle Online-Dienste spezielle Kompromisse betreffend Datenschutz und -sicherheit erfordern würden. Im Gegenteil: Heute ist unbestritten, dass das Sicherheitsniveau und die operative Transparenz von digitalen Plattformen meist höher ist als bei der eigenen Betriebsumgebung. Fakt ist aber, dass die entsprechenden Risikobeurteilungen lange hypothetisch und entkoppelt vom tatsächlichen Nutzen digitaler Technologien geführt wurden. Ein Grund dafür war vielleicht, dass ein konkreter und grossflächiger Anwendungsfall fehlte. Nun aber ist eine ganzheitliche Abwägung möglich. Diese muss nicht nur Risiken, sondern auch die Vorteile digitaler Lösungen gewichten. Notwendig ist nicht die Abschaffung, sondern die modernisierte Interpretation bestehender Anforderungen und Gesetze.
Schweizer Unternehmen und auch die öffentliche Hand benötigen jetzt Handlungsspielraum, die technologischen Möglichkeiten zur Wiederherstellung ihrer wirtschaftlichen Basis und für zukunftsgerichtete Innovation zu nutzen. Dies soll verantwortungsvoll und keinesfalls auf Kosten von nicht verhandelbaren Werten wie Transparenz, Sicherheit oder dem Schutz der Privatsphäre geschehen.
Der durch die Krise angestossene Erneuerungsprozess darf jetzt nicht abgewürgt werden. Die Gefahr ist real, denn viele Gesetze und regulatorische Anforderungen der Schweiz stammen aus der Zeit vor dem Internet und wurden bisher eher restriktiv ausgelegt. Schweizer Unternehmen und auch die öffentliche Hand benötigen jetzt Handlungsspielraum, die technologischen Möglichkeiten zur Wiederherstellung ihrer wirtschaftlichen Basis und für zukunftsgerichtete Innovation zu nutzen. Dies soll verantwortungsvoll und keinesfalls auf Kosten von nicht verhandelbaren Werten wie Transparenz, Sicherheit oder dem Schutz der Privatsphäre geschehen. Die Menschen werden Technologien nicht nutzen, wenn sie ihnen nicht vertrauen.
Gefordert ist also ein gesellschaftlicher Entscheidungsprozess, der als Resultat eine effektive und nachhaltige Innovationsbasis unter neuen Vorzeichen hervorbringt. Der Datenschutz wird dabei zum Innovationsfaktor, wenn er die bestehen Anforderungen im Kontext der technischen Gestaltungsoptionen und deren Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft lösungsorientiert bewertet. Der Geist ist aus der Flasche, jetzt ist der Blick nach vorne entscheidend. Ganz egal wie sich die neue Normalität gestaltet: Technologie wird immer eine tragende Rolle spielen.
(Dieser Artikel ist erstmals in der Handelszeitung Nr. 22 vom 28. Mai 2020 auf Seite 17 erschienen.)